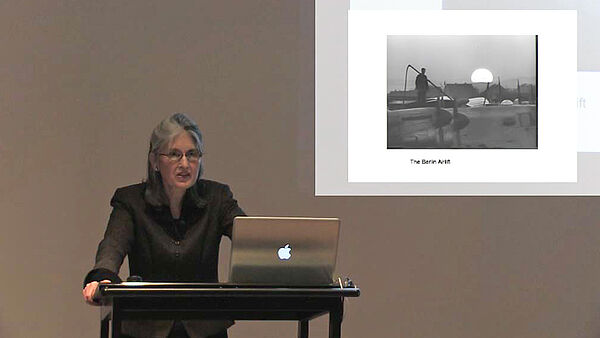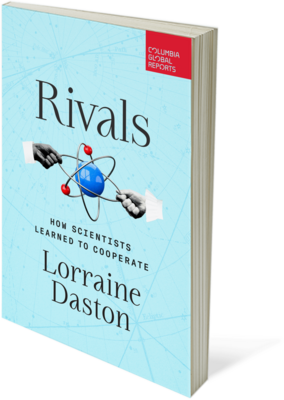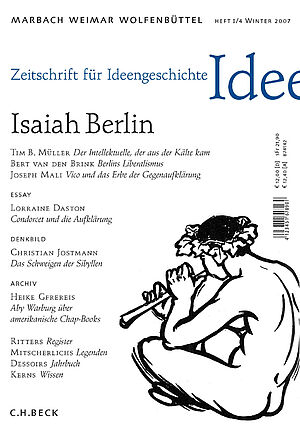Lorraine J. Daston, Ph.D.
Direktorin em.; Professorin, Committee on Social Thought
Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlin
Universität Chicago
Geboren 1951 in East Lansing, Mich., USA
Studium der Geschichte, Philosophie, Mathematik und Wissenschaftsgeschichte in Cambridge und in Harvard
Arbeitsvorhaben
Rethinking Risk in a Dangerous Age
Misfortune is the human lot, whether in the form of an ice age, a plague, or an earthquake, and cultures everywhere have found ways of cushioning themselves against the worst-case scenario. Pliable building materials in earthquake zones, dikes and levees in flood plains, quarantining the sick, and institutionalized solidarity are all forms of risk management. But the dominant method for taming risk in the contemporary world is insurance. Since the eighteenth century, insurance has grown from a canny bet on the success of long-distance mercantile ventures into an immense and immensely wealthy global system based on vast databases and complex mathematical modelling of both the probabilities of disaster and also the performance of the financial markets in which insurance companies invest their reserves.Like their customers, insurance companies hedge their bets by taking out insurance in their turn, so-called reinsurance. The biggest reinsurance companies in the world sit at the top of a pyramid of primary and secondary insurers. In the last fifty years, the risks reinsurance firms are being asked to cover have climbed steeply. Climate change has increased the frequency and intensity of disasters like hurricanes, wildfires, floods, and mudslides, and the ever-denser concentration of populations in cities has also multiplied the damage claims when a catastrophe strikes an urban area.
These factors are forcing the reinsurance industry to rethink their own attitudes toward risk, including investment risks. We are in the midst of a quiet revolution in the way that those masters of disasters, the reinsurance firms, radically revise the business of risk in our dangerous age.
Recommended Reading
Coen, Deborah R. The Earthquake Observers: Disaster Science from Lisbon to Richter. University of Chicago Press, 2013.
Daston, Lorraine. “What Is an Insurable Risk? Swiss Re and Atomic Reactor Insurance.” In Managing Risk in Reinsurance: From City Fires to Global Warming, edited by Niels Viggo Haueter and Geoffrey Jones, 230–247. Oxford University Press, 2017.
Kolloquium, 07.03.2023
Das Ende der Naturkatastrophen
Die Kategorie der reinen Naturkatastrophe, an der niemand schuld ist, stammt aus der Aufklärung. Zuvor gab es nur Katastrophen (im Mittelalter auf Latein tribulationes genannt), deren Ursachen gemischt und göttlichen, menschlichen und natürlichen Ursprungs waren und die eine Fülle von Schuldzuweisungen nach sich zogen. Im Zeitalter des menschengemachten Klimawandels geht uns die Kategorie der Naturkatastrophe rasch verloren – und damit auch der Begriff des schuldlosen Übels. Es ist noch gar nicht so lange her, dass die rechtliche Anerkennung von Katastrophen, für die niemand die Verantwortung trug und die zwar bedauerlich waren, sich aber der Berechnung oder Kontrolle durch den Menschen entzogen, als Zeichen des Fortschritts erschien: Wir hatten uns vom Joch religiöser Omen und Strafen befreit und lasen den Zorn Gottes nicht mehr in Ereignisse hinein, die einfach nur ein Teil des Naturgeschehens waren. Die Suche nach Schuldigen für die Schäden, die von Dürren oder Wirbelstürmen verursacht wurden, erschien uns so unaufgeklärt wie die Hexenjagd. Doch heute wollen aufgeklärte Menschen immer öfter wissen, ob Naturkatastrophen wirklich so natürlich sind, und stellen schwierige Fragen zur menschlichen Verantwortung – und zur Haftbarkeit.
Meine Frage lautet: Was passiert, wenn wir die aufgeklärte Kategorie der Naturkatastrophe verlieren und damit auch den Begriff eines schuldlosen Übels? Wie in der Aufklärung prallen in unseren Köpfen anscheinend große tektonische Platten aneinander. Der Kern des Naturbegriffs – dass sie autonom und dem menschlichen Willen gegenüber gleichgültig ist – scheint sich im Zeitalter des menschengemachten Klimawandels und der Gentechnik aufzulösen. Im Positiven wie im Negativen hat sich der Umkreis menschlicher Weitsicht und Macht – und damit auch der Umkreis menschlicher Verantwortung – zumindest in unserer Vorstellung so weit ausgedehnt, dass wir die Rollen mit der Natur tauschen: Für uns, ihre geduckten Kinder, ist sie nicht mehr die allmächtige Mutter (oder grausame Stiefmutter), sondern wir imaginieren sie als unsere Schutzbefohlene, als empfindlich und der Schonung bedürftig.
Diese metaphysischen und moralischen Veränderungen sind viel zu gewaltig, um sie in einem einzigen kurzen Vortrag zu erfassen. Ich möchte mich hier darauf konzentrieren, welche Auswirkungen die schwindende aufgeklärte Kategorie der reinen Naturkatastrophe und die damit einhergehenden Begriffe des schuldlosen Übels und der menschlichen Verantwortung haben. Doch anstatt diesen Entwicklungen in philosophischen Abhandlungen nachzugehen, konzentriere ich mich auf die konkrete Praxis, nämlich wie Gerichte und Versicherungen in Echtzeit neu definieren, was Katastrophen sind und wer für sie verantwortlich ist. Ich gehe davon aus, dass hier eine Metaphysik (und Ethik) im Werden ist: Diese neuen Praktiken im Umgang mit Katastrophen verändern unser Denken in Bezug darauf, was Natur und Verantwortung heute bedeuten.
Köpfe und Ideen 2014
Zwei mal drei macht vier, widewidewitt und drei macht neune ...
ein Porträt von Wendy Espeland, Jahnavi Phalkey, Theodore M. Porter, Lorraine J. Daston, Tong Lam, John Carson von Jürgen Kaube
Publikationen aus der Fellowbibliothek
Daston, Lorraine J. (New York, NY, 2023)
Rivals : how scientists learned to cooperate
Daston, Lorraine J. (Princeton, 2022)
Rules : a short history of what we live by The Lawrence Stone lectures
Daston, Lorraine J. (Berlin, 2018)
Gegen die Natur Against nature
Daston, Lorraine J. (Chicago, 2017)
Science in the archives : pasts, presents, futures
Daston, Lorraine J. (Jerusalem, 2015)
Before the two cultures : big science and big humanities in the nineteenth century Proceedings / The Israel Academy of Sciences and Humanities ; Vol. 9, No. 1
Daston, Lorraine J. (Chicago, Ill. [u.a.], 2013)
How reason almost lost its mind : the strange career of Cold War rationality
Daston, Lorraine J. (Berlin, 2012)
Festkolloquium für Hans-Jörg Rheinberger : Beiträge zum Symposium am 24. 1. 2011 im Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte Preprint ; 433
Daston, Lorraine J. (2012)
Wissenschaftsgeschichte und Philosophie : Hans-Jörg Rheinberger und l'esprit de la fleuve
Daston, Lorraine J. (2011)
The empire of observation, 1600-1800
Daston, Lorraine J. (Chicago, 2011)
Im Kolleg entstanden 17.10.23
Im Kolleg entstanden 12.07.22
Veranstaltungen
Lorraine J. Daston
Teresa Castro Martín | Lorraine J. Daston | Mark E. Hauber | Anthony Ossa-Richardson
Minou Arjomand | Johannes Böhme | Lorraine J. Daston | Magdalena Waligórska
Lorraine J. Daston | George E. Lewis | Yossi Yovel
Lorraine J. Daston
Lorraine J. Daston
Lorraine J. Daston | Raghavendra Gadagkar
Lorraine J. Daston
Lorraine J. Daston
Lorraine J. Daston
Lorraine J. Daston